Studium
Die Universität Bonn bietet über 200 (Teil-) Studiengänge in einem breiten Fächerspektrum von A wie Agrarwissenschaft bis Z wie Zahnmedizin an. Neben Bachelor- und Masterstudiengängen können auch Studiengänge mit Staatsexamen und theologischen Abschlüssen gewählt werden. Dabei bieten die Kombinationsmodelle im Bachelorbereich weitreichende Möglichkeiten für eine individuelle fachliche Schwerpunktsetzung und das differenzierte Angebot an Masterstudiengängen eine hervorragende Option für wissenschaftliche Vertiefung und Spezialisierung.
Die Universität ist für ihre forschungsnahen Studiengänge bekannt, die den Blick über die Fachwissenschaft hinaus eröffnen und in denen Studierende gefordert und gefördert werden. Viele der in Bonn lehrenden und forschenden Wissenschaftler*innen gehören zu den besten ihres Faches. Im internationalen Wettbewerb nehmen zahlreiche Fächer eine Spitzenstellung ein. Erfolgreiche Bonner Absolvent*innen besetzen Spitzenpositionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Studienorientierung und Uni Bonn entdecken
Die Universität Bonn bietet Schüler*innen aller Altersstufen vielfältige Möglichkeiten zum Kennenzulernen und zur Studienorientierung – von der Kinderuni bis hin zur individuellen Studienberatung.
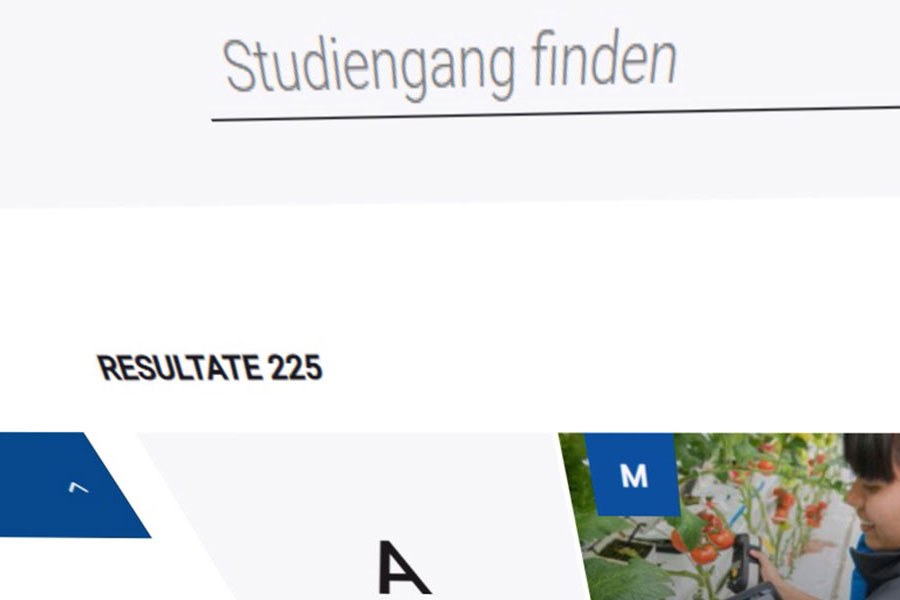
Studienangebot
Von A wie Agrarwissenschaft bis Z wie Zahnmedizin bietet die Universität Bonn weit über 200 Studienfächer im grundständigen und weiterführenden Studium an.

Bewerbung, Zulassung und Einschreibung
Sie planen an der Universität Bonn zu studieren und möchten wissen, wie Sie Ihren Studienplatz erhalten? Unser Bewerbungsguide leitet Sie zuverlässig und direkt zu dem für Sie richtigen Verfahren.
Studium und Praktikum im Ausland
Wenn Sie an der Universität Bonn studieren, haben Sie die Möglichkeit an den renommiertesten internationalen Universitäten Ihre Auslandssemester zu verbringen oder in Unternehmen und Einrichtungen im Ausland praktische Erfahrungen zu sammeln.
Internationale Studierende
Sie möchten in Bonn studieren und haben einen internationalen (Hoch-)Schulabschluss? Wir haben Ihnen alle Informationen zur Bewerbung, Finanzierung und dem Leben in Bonn zusammengestellt.

Beratung & Service
Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung in Ihrem Studium? In unserem Portal finden Sie die passenden Anlaufstellen und Ansprechpersonen für Ihr Anliegen.
Maximen für Studium und Lehre
Die Universität Bonn fördert und pflegt die Wissenschaften als Einheit von Forschung und Lehre. Als Volluniversität verfolgt sie in der Breite ihres Forschungs- bzw. Fächerspektrums das Ziel, junge Menschen für die Wissenschaften zu begeistern und sie in der Weiterentwicklung ihrer individuellen fachlichen Potenziale sowie ihrer Persönlichkeit bestmöglich zu fördern.
Semestertermine
Unter Semestertermine finden Sie den akademischen Kalender der Universität Bonn, Bewerbungs- und Einschreibefristen, Vorlesungszeiten und freie Tage sowie die Fristen für die Rückmeldung zum nächsten Semester.
Studienstart
Jeder Start ins Studium ist individuell – ein neuer Lebensabschnitt, der aufregend ist und gleichzeitig viele neue Möglichkeiten eröffnet. Alles was Sie für ein gutes Ankommen im Studium benötigen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Finanzierung & Förderung
Was ein Studium an der Universität Bonn kostet und welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, erklären wir Ihnen auf den folgenden Webseiten.
Bonner Studienbegleitprogramm „Be strong!“
„Be strong!“ ist das erste strukturierte Studienbegleitprogramm an der Universität Bonn. Die vielfältigen Angebote in „Be strong!“ sind auf alle Phasen des Studiums zugeschnitten und unterstützen Sie dabei, sich im Studium zurechtzufinden, fachliche und methodische Kompetenzen auf- und auszubauen sowie Ihre persönlichen Ressourcen zu stärken.
31.501
Studierende
6.769
Promovierende
4.285
Studienabschlüsse pro Jahr
Lesen Sie auch
Bundesstadt Bonn
Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Freizeit, internationales Flair – die Bundesstadt Bonn hat viel zu bieten.
Unileben
Studieren in Bonn bedeutet auch, in einem fantastischen Umfeld immer wieder auftanken und neue Ideen und Anreize aufnehmen zu können.
Hochschulsport
Der Hochschulsport bietet mit seinem umfangreichen Kursangebot beste Voraussetzungen, um sich regelmäßig sportlich zu betätigen und so einen guten Ausgleich zum Lernen zu schaffen.


